Organisation von Kommunikation durch Boten (Ulrich von Liechtenstein, Frauendienst): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
<HarvardReferences /> | <HarvardReferences /> | ||
== Primärliteratur == | == Primärliteratur == | ||
* [*FD] Ulrich <von Liechtenstein>: Frauendienst. Hrsg. v. Franz Viktor Spechtler. Göppingen: Kümmerle, 1987 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 485) (zit. als FD: ''Strophe | * [*FD] Ulrich <von Liechtenstein>: Frauendienst. Hrsg. v. Franz Viktor Spechtler. Göppingen: Kümmerle, 1987 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 485) (zit. als FD: ''Strophe,Vers''). | ||
== Sekundärliteratur == | == Sekundärliteratur == | ||
* [*Capurro 2011] Capurro, Rafael: "Theorie der Botschaft". In: Capurro, Rafael / Holgate, John (Hrsg.): Messages and Messengers. Angeletics as an Approach tot he Phenomenology of Communication. München: Fink, 2011 (Schriftenreihe des International Center for Information Ethics (ICIE) Bd. 5). | * [*Capurro 2011] Capurro, Rafael: "Theorie der Botschaft". In: Capurro, Rafael / Holgate, John (Hrsg.): Messages and Messengers. Angeletics as an Approach tot he Phenomenology of Communication. München: Fink, 2011 (Schriftenreihe des International Center for Information Ethics (ICIE) Bd. 5). | ||
Version vom 13. Juni 2013, 02:11 Uhr
Definition des Botenbegriffs
In Ulrichs von Liechtenstein „Frauendienst" nehmen Boten eine zentrale (Vermittler-)Rolle ein. Sie überwinden immer wieder räumliche und semantische (bzw. soziale) Grenzen - etwa zwischen Ulrich und der vrowe - und ermöglichen so den ‚Dialog‘ zwischen zwei voneinander getrennten Gesprächspartnern. Durch diese Funktion etablieren sie verschiedene Formen kommunikativer Organisation. Der folgende Artikel untersucht, ausgehend von den Botenfiguren[1] niftel, Knecht der vrowe sowie Bote einer Dame, wie Kommunikation im FD innerhalb des jeweiligen Systems funktioniert. Zugunsten dieser Analyse werden im Folgenden einige Botenfiguren - etwa der ‚politische‘ Bote (FD: 179,1), der Bote, der ein Turnier ankündigt (FD: 362,1ff.) oder der Protagonist Ulrich als falscher Bote (FD: 366,2) - vernachlässigt. Bei der Bestimmung der verschiedenen Kommunikationssysteme greift der Artikel auf Konzepte der Medientheorie sowie der Ökonomik zurück, um mithilfe basaler Konzepte aus diesen Disziplinen das Verhältnis der im FD an der Kommunikation beteiligten Figuren zu beschreiben.
Zunächst muss eine für den Artikel zweckmäßige Definition des Botenbegriffs erfolgen: Bei einem Boten muss es sich im Folgenden 1. um eine literarische Figur handeln, die 2. als Nachrichtenübermittler auftritt. Das von Ulrich als „getriuwer bot“ (FD: 1. Büchlein,2) bezeichnete 1. Büchlein erfüllt diese Voraussetzungen beispielsweise nicht.
Der Bote ist durch seine Funktion der Nachrichtenübermittlung Teil eines sprachlichen Kommunikationszusammenhangs. Kommunikation bedeutet hier, dass ein Sender einem Empfänger eine Nachricht übermittelt.[2] Dieser sprachliche Kommunikationsvorgang vollzieht sich zunächst unmittelbar, d.h. Sender und Empfänger sprechen direkt miteinander. Der Bote tritt genau dort in einen solchen Gesprächszusammenhang ein, „wo eine unmittelbare Interaktion zwischen den Kommunizierenden gerade nicht gegeben ist, wo eine Kommunikation [...] sich gerade nicht als Wechselrede realisiert.“ [Krämer 2008: S. 10] Der Bote erweitert somit das dualistische Konzept (Sender-Empfänger) und wird zum Überbringer der Nachricht.
Während Sender und Empfänger „Subjekte“ [Hahn 2008: S. 64] der Kommunikation darstellen, ist der Bote lediglich „transmitter und receiver [...] und, aus heutiger Sicht, eine mailbox“ [Capurro 2011: S. 59] für Nachrichten. Er stellt in dieser Funktion eine kommunikative ‚Figur des Dritten‘ dar und ist gewissermaßen Teil und ‚Nicht-Teil‘ der Kommunikation:
Indes der Absender der Botschaft in derselben präsent ist, ist er räumlich - d.h. beim Empfänger - abwesend. Der Bote wiederum ist nach Margreth Egidi „nicht sprechend präsent“ [Egidi 2011: S. 108], überbringt dem Empfänger jedoch die Botschaft - im FD etwa Brief, Büchlein oder Lied. Der Empfänger ist sowohl als kommunikatives Subjekt, als auch in der Begegnung mit dem Boten präsent. Torsten Hahn begreift den Unterschied zwischen Boten (d.h. Mittlern) und Subjekten folgendermaßen: „Boten kommunizieren nicht, Subjekte schon“ [Hahn 2008: S. 64]. Subjekte sind demnach im Rahmen eines Gesprächszusammenhangs für die Sinnstiftung, Boten lediglich für die unverfälschte Übertragung des Sinns zuständig, womit sie gewissermaßen eine technische Funktion erfüllen. „Subjekte sollen [...] ohne Einmischung aus der Welt der kommunikationstechnischen Infrastruktur" [Hahn 2008: S. 65] kommunizieren. Kombiniert man die Überlegungen Hahns und Egidis bezüglich der Funktion des Boten[3], so kann man die Unterscheidung zwischen Subjekt (Sender, Empfänger) und Mittler (Bote) folgendermaßen darstellen:
| Ulrich | Bote | vrowe | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Subjekt (Sender) |
Hybride (Mittler) |
Subjekt (Empfänger) |
| Präsenz | physisch (technisch) abwesend anwesend in der Botschaft |
physisch (technisch) anwesend nicht sprechend präsent |
doppelt präsent empfängtBotschaft und Boten |
Für die Verortung der Botenfigur ist insbesondere ihr Verhältnis zu den Subjekten, - insb. zum Absender - wichtig. Sybille Krämer hat herausgearbeitet, dass das (Abhängigkeits-)Verhältnis zwischen dem Boten und seinem Auftraggeber ein besonderes ist: Boten sind heteronom, d.h. „nicht selbstständig[e]“[Krämer 2008: S. 112] Figuren. Sie sind insofern fremdgesteuert, als sie im Auftrag eines Subjekts handeln und so als dessen „Extension“ [Krämer 2008: S. 113] oder „Substituierung“ [Wenzel 1997: S. 96] bzw. als „Abspaltung“ [Egidi 2011: S. 125][4] von diesem begriffen werden können.
Der Absender schickt damit nicht nur eine Nachricht, sondern auch einen Boten auf den Weg zum Empfänger. Dieser Bote ist - wie bereits in der Übersichtstabelle dargestellt worden ist - „nicht sprechend präsent“, sondern übermittelt lediglich die Aussage des Absenders. Krämer bemerkt hierzu: „Der Bote ist nicht Souverän seiner Rede, und so wundert es nicht, dass er in seiner Übertragungsfunktion ersetzbar ist durch nichtpersonale Entitäten.“[Krämer 2008: S. 121]
Der Bote vergrößert (im technischen Sinne) gewissermaßen nur die Reichweite des Absenders, um sicherzustellen, dass die Nachricht den Empfänger erreicht.
Diese ‚Reichweitenvergrößerung‘ ist bei genauerer Betrachtung eine weitere Funktion des Boten: Er ist hier nicht nur für eine unverfälschte, ‚nachrichtentechnische Übermittlung‘ zuständig, sondern erfüllt hier zudem eine phatische, d.h. Kontakt herstellende, Funktion: Der Bote ist insofern „Keimzelle der Sozialität“, als er nicht nur „gesandt, sondern auch auf jemanden hin gerichtet“ [Krämer 2008: S. 114] wird und somit eine Beziehung zwischen Sender und Empfänger herstellt, die ohne ihn womöglich nicht bestehen würde. Ein Bote birgt demnach zugleich „Sozial[-]“ und „Technikpotential“ [Krämer 2008:S 114] in sich, muss aber in jedem Fall die Nachricht unverfälscht weiterleiten, darf also keine sinnstiftende bzw. -verändernde Funktion einnehmen.
Boten und Kommunikationssysteme im FD
Die niftel als ‚Schaltzentrale‘
Ulrich charakterisiert seine niftel, die als erste Botin des FD in Erscheinung tritt, als „diu guote“ (FD: 53,4), zu der er in einem freundschaftlichen Verhältnis - „die guot enpfie mich also wol/ als vriunt den vriunt enphahen sol.“(FD: 70,3f] - steht. Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Sender und Bote haben Karina Kellermann und Christopher Young festgestellt, dass sich Botenfiguren durch Zuverlässigkeit, Loyalität und Vertrautheit mit Absender und Empfänger der Botschaft auszeichen [Kellermann / Young 2003: S. 328]. Im FD ist es die Verwandtschaft zwischen Ulrich und niftel, die diese drei Eigenschaften sicherstellt. Darüber hinaus ist die niftel schon mit der vrowe bekannt (FD 54,6), wodurch auch hier, zwischen den beiden Frauen, Vertrautheit bereits vorhanden ist.
Ulrich kann seine Nichte nach einigem Zögern ihrerseits (FD: 59,1) als Botin, die sich zur Zuverlässigkeit verpflichtet - „ich sage ir allen dinen muot/ des wil ich si verswigen niht“(FD: 64,4f.) -, gewinnen (FD: 64,4) und sendet durch sie der vrowe ein Lied. Die niftel übermittelt der vrowe die Nachricht und bestätigt den Inhalt selbiger (FD: 73,1ff.), wird jedoch vom der Empfängerin abgewiesen und zugleich dazu aufgefordert, dieser nicht weiter als Ulrichs Botin entgegenzutreten - „du solt der rede gar gedagen/ und mir von im niht mere sagen“ (FD: 74,7f.). Bemerkenswert ist hierbei, dass die niftel durch ihren Botengang zeitweise in ein anderes Verhältnis zur vrowe tritt: Während sie und die vrowe zunächst - vor dem Botengang - noch gemeinsam als Subjekte über Ulrich sprechen (FD: 54,6), kann die niftel als Botin lediglich Ulrichs Nachricht übermitteln und bestätigen. Erst nachdem die vrowe sie als Botin abgewiesen hat, ist sie wieder in der Lage, unabhängig von der Nachricht Ulrichs, ihre eigenen Gedanken zu formulieren:
Mittelhochdeutscher Text (FD: 77-78): __________ Neuhochdeutsche Übersetzung: Do sprach ich: "vrowe, enzürnet niht! __________ Da sprach ich: »Herrin, zürnet nicht, alsölcher dinge vil geschiht, __________ denn solche Dinge gibt es viel, daz ein junc man so hohe gert, __________ ein junger Mann will hoch hinaus, des er ist immer ungewert. __________ das soll man ihm doch nicht verwehr'n. sie werbent hohe durch hohen muot, __________ Sie werben in dem Hochgefühl, sie jehent, ez si gar ze eren guot, __________ sie sagen, daß das Anseh'n steigt, daz hoch gemuotes ritters lip, __________ wenn denn ein Ritter hochgemut diene und werbe umb werdiu wip. __________ so dient und wirbt um eine Frau. __________ Ir sit im ze lobe gar geborn. __________ Ihr seid für ihn zum Preis gebor'n. nu waz dar umb? er hat erkorn __________ Was soll nun sein? Er hat erkor'n iuch ze frowen sine zit. __________ euch als die Herrin fürderhin. ir sit, an der sin wunne lit, __________ Ihr seid's, an der er Freude hat, ir sit, an der sin saelde stat,, __________ Ihr seid's, an der sein Glück nur hängt, ir sit, diu sinen dienest hat __________ ihr seid's, die seinen Dienst genießt immer mer gar sunder wanc - __________ auf immer ohnme Wankelmut - daz ist sin muot und sin gedanc, __________ das ist sein Wille und sein Sinn.«

Auch das Verhältnis zwischen Ulrich und der niftel ist nach dem Botengang wieder das von zwei Subjekten: Die Nichte kann ihrem Verwandten eines „vriundes rat“ (FD: 81,3) geben und bittet ihren Neffen darum, dass dieser den Minnedienst aufgebe (FD; 81,7f.). Sie erklärt - nachdem dieser den Rat ausschlägt - dass sie fortan keine Botin mehr sein wolle (FD: 83.1).
Im weiteren Verlauf fungiert die niftel nicht mehr als direkte Botin zwischen Ulrich und der vrowe, sondern weist ihrerseits Boten an, Ulrichs Nachrichten zu übermitteln[5]. So gibt sie beispielsweise einem Boten den Auftrag, der vrowe von Ulrichs gelungener Mundoperation zu berichten (FD: 113,5). Obwohl die niftel damit weniger als Botin, als vielmehr als koordinatorisches Bindeglied zwischen Ulrich und ihren Boten fungiert, nennt Ulrich sie dennoch weiterhin „getriwer bot“ (FD: 109,2)[6]. Zwischenzeitlich verknüpft die niftel auch eigene Nachrichten mit den Botschaften Ulrichs - so z.B. Brief (b: ) und Lied 4 (FD: Brief (b: ), nach 320) -, wodurch sie einerseits zwischen Ulrich und ihrem Boten vermittelt (Lied 4) und andererseits selbst, mithilfe desselben Boten, mit der vrowe kommuniziert (Brief (b: )).
Die von der niftel entsendete Botenfigur[7] wird nicht näher charakterisiert; allein ihre Funktion als Bote dient als Beschreibung, wodurch die Figur auf ihre (technische) Vermittlungsfähigkeit reduziert wird. Abbildung 1 zeigt, wie die Kommunikation zwischen Ulrich und vrowe mittels der niftel und ihres Boten funktioniert. Das Kommunikationssystem ist auf die niftel als zentrale Schaltzentrale hin ausgerichtet. Sie organisiert die Boten und vernetzt somit Ulrich und die vrowe, um hier Kommunikation zu ermöglichen.
Knecht der vrowe als ‚selbstständiger‘ Bote
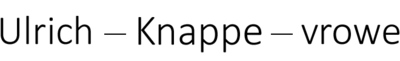
Ulrich befindet sich auf dem Weg nach Graz, um sich dort einer Mundoperation zu unterziehen, als er den Knecht der Herrin (FD: 90,3], mit dem er bereits bekannt ist (FD: 90,4), trifft. Der Knecht möchte der vrowe von dieser Neuigkeit berichten, wird also zu einem Boten, ohne dass Ulrich ihm ausdrücklich diesen Auftrag gibt[8]. Er stößt in Graz wieder zu Ulrich hinzu und berichtet diesem - nach gelungener Operation -, dass die vrowe die Neuigkeit vom Vorhaben Ulrichs zunächst nicht glauben wollte (FD: 98,4), dann jedoch lediglich als „tumplich“ (FD: 98,7) bezeichnete. Der Knecht entschließt sich abermals aus eigenem Antrieb, die Nachricht von der geglückten Operation an die vrowe zu übermitteln (FD: 99,6ff.).
Charakteristisch für den Knecht der vrowe ist demnach, dass er sich ohne explizit geäußerten Botenauftrag dazu entschließt, Neuigkeiten zu übermitteln. Gemessen an der eingangs aufgestellten Definition kann er zwar als Bote bezeichnet werden, da er 1. literarische Figur ist und 2. Nachrichten übermittelt, verglichen mit der niftel zeichnet sich der Knecht allerdings insbesondere dadurch aus, dass er aus eigener Motivation heraus, d.h. gerade nicht fremdbestimmt, Botengänge erledigt. Er befindet sich damit gewissermaßen im Spannungsfeld zwischen Subjekt und Mittler. Abbildung 2 erscheint zwar als gewöhnliche Kommunikationssituation zwischen Sender (Ulrich), Empfänger (vrowe) und Mittler (Knecht), unterscheidet sich jedoch insofern deutlich von diesem, als hier keine direkten Botenaufträge durch die Subjekte erteilt werden; der Mittler selbst entscheidet sich dazu, eine Nachricht zu überbringen und bleibt dabei Bote, da er die Nachricht zwar gewissermaßen selbst auswählt, diese aber unverändert an einen Empfänger weitergibt.
Der Bote einer Dame als ‚Tauschmedium‘

Ein weiterer Bote wird Ulrich von einer Dame aus Mitleid - „sie wolde von herzen immer clagen/ miniu sendelichiu leit“ (FD: 354,2f.) - gesandt (FD: 353,7f.). Zwischen der Dame und Ulrich kommt es über den Boten mehrfach zu Austauschen: Ulrich erhält vier Bücher und sendet der Dame seinen Dank. Die Dame schickt Ulrich eine Melodie, zu der er einen passenden Text verfasst, welchen er wiederum über den Boten versendet. Daraufhin erhält Ulrich ein „hundelin“ (FD: 361,1). Diese Form der Kommunikation weist starke Ähnlichkeit mit dem ökonomischen System des Warenaustauschs auf, wobei im vorliegenden Fall des FD der Bote der Dame als (technisches) Tauschmedium fungiert. Abbildung 3 zeigt diesen Verhältnis deutlich: Die Dame schickt Ulrich etwas (blau) und erhält dafür wiederum - gewissermaßen als Gegenleistung - etwas (orange).
Zusammenfassung
Der Artikel konnte anhand von drei Beispielen zeigen, wie das Verhalten einer Botenfigur Kommunikation strukturieren kann. Es ist nochmals zu betonen, dass alle drei Figuren nach der eingangs aufgestellten Definition Boten sind. Gerade hinsichtlich des Knechts könnte dies irritieren, da es scheint, als handle er als autonomes Subjekt. Hier muss darauf geachtet werden, in welchem Verhältnis die Figur zu der von ihr vermittelten Nachricht steht: Der Knecht wählt zwar in einigen Situationen die Nachrichten, die er übermittelt, selbst aus, verändert sie aber nicht. Damit ist er noch immer 1. literarische Figur und 2. Nachrichtenübermittler.
Das wichtigste Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass Kommunikation scheinbar weniger durch Subjekte, als vielmehr durch Mittler bestimmt wird. Mit anderen Worten: Wie die Nachricht vermittelt wird ist wichtiger, als von wem sie kommt und an wen sie adressiert ist. Daraus folgt konsequenterweise, dass die, bereits zu Beginn des Artikels festgestellte, zentrale Rolle der Boten im FD - in dem Kommunikation über Dritte[9] wichtiges Strukturmerkmal ist - bestätigt werden muss.
Anmerkungen
- ↑ Anm.: Der Artikel verzichtet bewusst auf eine Untersuchung der Literarisierung und der Begriffsgeschichte der Botenfigur. Vgl. hierzu [Göhler 1997: S. 77f.] und [Wenzel 1997: S. 92f.].
- ↑ Anm.: Diese Grundannahme ist Ausgangspunkt von vielen Kommunikationsmodellen. Vgl. etwa Jakob Bühlers Organonmodell oder Roman Jakobsons Kommunikationsmodell; Vgl. dazu [Holenstein 1989: S. 12f.].
- ↑ Vgl. [Egidi 2011: S. 108] sowie [Hahn 2008: S. 65].
- ↑ Vgl. hierzu auch Mercerons Unterscheidung zwischen „structure triangulaire“ (Sender-Bote-Empfänger) und „structure non-triangulaire“ ({Sender und Bote als Einheit}-Empfänger) [Merceron 1998: S. 30].
- ↑ Anm.: Vgl. z.B. FD: 160,1; FD: 313,6; FD: 314,4ff.
- ↑ Anm.: An dieser Stelle ist zudem interessant, dass Franz Viktor Spechtler in seiner Übersetzung „min niftel“ (FD: 113,2) als „die Botin“ ins Neuhochdeutsche übersetzt, selbst demnach wohl auch davon ausgeht, dass die Nichte hier in einer Botenrolle handelt.
- ↑ Vgl. FD 113; FD 160; FD 322.
- ↑ Anm.: Ulrich entgegnet lediglich: „Nu sag ez swem du wil“ (FD: 93,1).
- ↑ Anm.: Dies gilt zumindest für den 1. Dienst.
Literaturverzeichnis
<HarvardReferences />
Primärliteratur
- [*FD] Ulrich <von Liechtenstein>: Frauendienst. Hrsg. v. Franz Viktor Spechtler. Göppingen: Kümmerle, 1987 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 485) (zit. als FD: Strophe,Vers).
Sekundärliteratur
- [*Capurro 2011] Capurro, Rafael: "Theorie der Botschaft". In: Capurro, Rafael / Holgate, John (Hrsg.): Messages and Messengers. Angeletics as an Approach tot he Phenomenology of Communication. München: Fink, 2011 (Schriftenreihe des International Center for Information Ethics (ICIE) Bd. 5).
- [*Hahn 2008] Hahn, Torsten: „Der Page der Königin und der Subalterne des Ministers. Botengänge in der Literatur“. In: Engell, Lorenz / Siegert, Bernhard / Vogl, Joseph (Hrsg.): Agenten und Agenturen. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität, 2008, S. 63-71.
- [*Egidi 2011] Egidi, Margreth: „Der schwierige Dritte. Zur Logik der Botenlieder vom frühen Minnesang bis Reinmar“. In: Münkler, Marina (Hrsg.): Aspekte einer Sprache der Liebe. Formen des Dialogischen im Minnesang. Bern: Lang, 2011 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge Bd. 21), S. 107-126.
- [*Göhler 1997] Göhler, Peter: "Zum Boten in der Liebeslyrik um 1200". In: Wenzel, Horst (Hrsg.): Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter. Berlin: Erich Schmidt, 1997 (Philologische Studien und Quellen Bd. 143), S. 77-85.
- [*Holenstein 1989] Holenstein, Elmar: „Einführung: Von der Poesie und der Plurifunktionalität der Sprache“. In: Jakobson, Roman: Poetik. ausgewählte Aufsätze 1921 - 1971. Hrsg. v. Elmar Holenstein. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989, S. 7-60.
- [*Kellermann / Young 2003] Kellermann, Karina / Young, Christopher: „You’ve got mail! Briefe, Büchlein, Boten im ‚Frauendienst‘ Ulrichs von Liechtenstein‘“. In: Berteilsmeier-Kirst, Christa / Young, Christopher (Hrsg.): Eine Epoche im Umbruch. Volkssprachliche Literalität 1200-1300. Tübingen: Niemeyer, 2003, S. 317-344.
- [*Klinger 1997] Klinger, Judith: "Potentiale und Grenzen der Kommunikation im 'Frauendienst'". In: Wenzel, Horst (Hrsg.): Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter. Berlin: Erich Schmidt, 1997 (Philologische Studien und Quellen Bd. 143), S. 106-126.
- [*Krämer 2008] Krämer, Sybille: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008.
- [*Linden 2004] Linden, Sandra: Kundschafter der Kommunikation. Modelle höfischer Kommunikation im Frauendienst Ulrichs von Liechtenstein. Tübingen / Basel: Francke, 2004 (Bibliotheca Germanica Bd. 49).
- [*Merceron 1998] Merceron, Jaques: Le message et sa fiction. La communication par messager dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1998 (Modern Philology Bd. 128).
- [*Spechtler 2006] Spechtler, Franz Viktor: „Die Stilisierung der Distanz. Zur Rolle des Boten im Minnesang bis Walther und bei Ulrich von Liechtenstein“. In: Auer-Müller, Michaela / Müller, Ulrich / Schmidt, Siegfried (Hrsg.): Gesammelte Abhandlungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. Göppingen: Kümmerle, 2006 (Göppinger arbeiten zur Germanistik Bd. 736), S. 223-246.
- [*Wenzel 1997] Wenzel, Horst: "Boten und Briefe. Zum Verhältnis körperlicher und nichtkörperlicher Nachrichtenträger". In: Ders. (Hrsg.): Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter. Berlin: Erich Schmidt, 1997 (Philologische Studien und Quellen Bd. 143).