Schuld, Sühne und Erlösung (Wolfram von Eschenbach, Parzival)
Schuld, Sühne und Erlösung sind im Parzival Wolframs nicht so eindeutig zu klären, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Jeder der Begriffe ( Schuld - Sühne - Erlösung) kann aus zumindest zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, die es gilt herauszuarbeiten.
Einleitung
Die im Parival Wolframs angelegte Handlungsstruktur scheint auf den ersten Blick denkbar einfach, ja geradezu prototypisch. Der auserwählte und zunehmend anerkannte Held Parzival versagt in dem entscheidenden Moment, wird in aller Öffentlichkeit geächtet, stürzt in eine tiefe Depression, kämpft sich wieder hoch und besteht letzten Endes die große finale Prüfung und erlöst damit die Gesellschaft. Doch Wolfram wäre nicht Wolfram und Parzival wäre nicht so wirkungsmächtig rezipiert worden, wenn nicht neben dieser oberflächlichen Handlungsebene zumindest eine weitere, tief schürfendere Bedeutungsebene möglich wäre. Der Artikel versucht, in Abgrenzung zur – ebenfalls vollkommen berechtigten – offensichtlichen Handlung, jene subtiler und vager angelegte Deutungsebene herauszuarbeiten; alles unter der Trias: Schuld – Sühne – Erlösung.
Zur Frage der Schuld
Auf den ersten Blick scheint die Sachlage klar und eindeutig. Parzival kommt zum Gral nach Munsalvaesche, tritt vor Anfortas und – versagt: Er versäumt es, die Mitleidsfrage zu stellen. Für dieses Versagen Parzvials können mindestens zwei Gründe angeführt werden
- Parzival lädt Schuld auf sich: Tötung Ithers, Schändung Jeschutes, Tod der Mutter[1]
- Parzival legt Gurnemanz‘ Lehren zu dogmatisch aus
Um dieses vermeintliche Versagen Parzivals zu relativieren, bedarf es einer intensiveren Betrachtung Parzivals Herkunft:
Seinen Ausgang nimmt die eigentliche Parzivalshandlung damit, dass seine Mutter, Herzeloyde, ihn nach seiner Geburt von jeglicher «höfischen» Welt fernhalten will. Sie erzieht ihn fernab der Zivilisation, in einem Wald. Dort genießt er weder eine Ausbildung in ritterlichen Tugenden, wovor ihn seine Mutter ja bewusst schützen will, noch ist ihm eine ernstzunehmende religiöse Erziehung vergönnt. Auf seine Nachfrage, was Gott sei, vermittelt ihm seine Mutter nur ein kindlich-naives Bild von Gott:
|
» sun, ich sage dirz âne spot. |
_____ |
„Mein Sohn, ich will’s dir sagen, |
|
er ist noch liehter denne der tac, |
_____ |
ganz im Ernst: Er ist noch heller |
|
der antlitzes sich bewac |
_____ |
als der Tag; Er macht sich |
|
nâch menschen antlitze. |
_____ |
zum Ebenbild des Menschen. |
|
sun, merke eine witze, |
_____ |
Und merke dir die Lehre, Sohn: |
|
und flêhe in umbe dîne nôt: |
_____ |
bete zu Ihm in der Not. |
|
sîn triwe der werlde ie helfe bôt. « |
_____ |
Schon immer stand Er zu den Menschen..“ [2] |
Die unzureichende und defizitäre Erziehung Parzivals allein reicht aber nicht aus, um die Frage der Schuld aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.[3] Dazu ist es interessant zu sehen, wie Parzival nach Munsalvaesche, also zum Gral, gelangt.
| »mit gewalt den zoum daz ros | _____ | „Sein Roß ließ er wild die Zügel schleifen |
| truog über ronen und durchez mos: | _____ | über Stämme und durch Sumpf |
| wandez wîste niemens hant. « | _____ | es war da keine Hand die lenkte.“[4] |
Hatte er zuvor noch Condwirarmurs gebeten, ihm „urloup“ zu gewähren, damit er seine Mutter besuchen kann, so überlässt er beim Losreiten bewusst seinem Pferd die Zügel.[5]Durch das engmaschige und eigentlich undurchdringbare Netz von Verteidigungsposten um die Gralsburg herum, gelangt Parzival also unversehrt nach Munsalvaesche – wie auch später(Vgl. Anm. 4) lässt sich hinter der Lenkung des Pferdes eben doch Gottes langer Arm vermuten: Parzival wurde bewusst zum Gral berufen; er ist eben nicht zufällig vorbei geritten.
Für die Frage der Schuld ist das ein nicht zu überschätzender Sachverhalt. Entscheidet doch bewusst eben jene transzendente und unfehlbare Instanz, dass der Gralsritter auch zum Gral gelangt. Es wird also jemand berufen, der aufgrund seiner defizitären Erziehung und seiner mit Sünden beladenen Seele letztlich vor dem Gral überhaupt keine Chance auf Erfolg hat. Pointiert könnte man feststellen: Der Gral beruft den Richtigen zur falschen Zeit und ist am Scheitern selbst schuld.
Zur Frage der Sühne
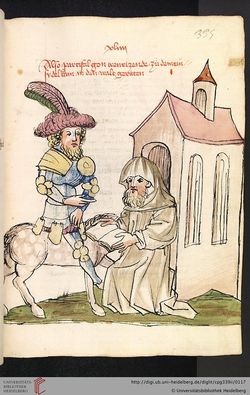
Nach dem vermeintlichen Versagen Parzivals und seiner öffentlichen Ächtung am Artushof durch Cundry, ist Parzival also gezwungen seine „êre“ wiederherzustellen. Hinzu kommt, dass er sein Gottesverhältnis klären muss, nachdem er sich zwischenzeitlich vollständig von Gott losgesagt hatte und die Theodizeefrage gestellt hatte (siehe auch Hauptartikel: Parzivals Gottesbild). Wieder scheint auf den ersten Blick alles klar. Parzival erringt großartigen ritterlichen Ruhm, klärt sein Gottesbild beim frommen Einsiedler Trevrizent und wird anschließend zum Gral berufen – jetzt erfolgreicher als im ersten Anlauf. Doch diese „innere Umkehr“ Parzivals wurde in der Forschung mit Recht immer wieder angezweifelt (vgl. Bumke, Fußnote folgt). Parzival dringt nicht zu einem Zustand der Erkenntnis seiner Verfehlungen durch, sondern bekommt sie lediglich vorgehalten. Er benötigt immer wieder Leute (Gurnemanz, Sigune, Trevrizent…), die ihm seine Fehltritte aufzeigen. Eine Gabe zur Reflexion weist der Gralsritter bis zuletzt nicht richtig auf. Allein das Aufzeigen der Verfehlungen durch Personen aus seinem Umfeld scheint aber nicht auszureichen; er muss auch immer wieder darauf hingewiesen werden, wie er sich ein zweites Mal vorm Gral zu verhalten habe. Zu einem selbstbestimmten und aus sich selbst erfolgreichen Grals-Ritter wird Parzival jedenfalls nicht – er bleibt die von der Gesellschaft indoktrinierte und determinierte Erlöserfigur.
Zur Frage der Erlösung
Parzival gelingt es im zweiten Anlauf nun endlich die Mitleidsfrage zu stellen: Er besteht vor dem Gral. Anfortas und die Gralsgesellschaft können aufatmen – der leidende Gralskönig wurde geheilt und damit die Gesellschaft von ihrem Übel befreit. Doch diese Sichtweise scheint bei eingehenderer Betrachtung zu beschränkt und wird auch von Wolfram nur in einem bezeichnend kurzen Abschnitt abgehandelt (vgl. Pz. XVI, 796, 3-15). Der große Rest des sechzehnten Buches widmet sich eben nicht Anforts, seinen geheilten Leiden und die damit einhergehende Erlösung der Gesellschaft - ganz im Gegenteil: Der Geheilte tritt völlig in den Hintergrund. Der eigentlich Erlöste ist der Erlöser selbst. Er hat sich von seinem Versagen der ersten Begegnung mit dem Gral, von der zuvor aufgeladenen Schuld und seiner Abkehr von Gott erlöst und kann deshalb im Anschluss auch zum Gralskönig erhoben werden. Trotz seines nur bedingt geklärten Gottesverhältnis hat er seinen ihm zugeschrieben Platz in der Gesellschaft gefunden und ist deswegen in seinem sozialen Status vollständig rehabilitiert. Die Erlösung des Anfortas durch die Mitleidsfrage Parzivals ist die Selbsterlösung Parzivals von den Schatten der Vergangenheit.
Anmerkungen
- ↑ Vgl. dazu auch den Artikel: Parzivals tumpheit
- ↑ Wolfram von Eschenbach: Parzival, hrsg. von Eberhard Nellmann, übertragen von Dieter Kühn, Frankfurt a. M. 1997, 203f.
- ↑ Für das dogmatische Auslegen der Lehren Gurnemanz‘, in gewisser Weise auch für die Schändung Jeschutes, kann Parzival mit seiner Herkunft und Erziehung entschuldigt werden. Nicht aber für die Tötung Ithers: Als Jäger muss Parzival den Tod des Gegners billigend in Kauf genommen haben.
- ↑ Wolfram 1997, 375.
- ↑ Das Motiv des „Zügel loslassen“ soll später ein zweites Mal auftauchen: Parzival überlässt seinem Pferd die Zügel, um sein Gottesverhältnis zu klären und gelangt prompt zum frommen Einsiedler Trevrizent (vgl.: Pz. IX, 452, 1-9).